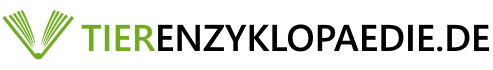Die Geburtshelferkröte ist unter den einheimischen Fröschen insofern ungewöhnlich, als sie an Land brütet und ihre Eier nicht im Wasser ablegt, sondern die eigentliche Brutpflege übernimmt. Das Männchen wickelt die Laichschnüre des Weibchens um seine Hinterbeine und trägt so die Schar der Eier bis zum Schlüpfen mit sich herum.
Eine weitere Besonderheit der Kröte ist, dass während der Paarungszeit ihr heller Ruf, der an den Klang einer Glasglocke erinnert, häufig zu hören ist. Sowohl die Männchen als auch die Weibchen machen ihn hörbar. Aus der Ferne klingen die Geräusche einer Gruppe von rufenden Kröten wie das Läuten einer Glocke, was erklärt, warum die Art auch als „Glockenfrosch“ bekannt ist.
Ihr natürlicher Lebensraum sind die unverbauten Fluss- und Bachauen der Mittelgebirge. Heute bevorzugt die Kröte sonnige, warme und weitgehend vegetationslose Lebensräume wie Abgrabungen oder Bahndämme, aber auch Gärten und Weideflächen und stellt kaum besondere Ansprüche an ihre Larvengewässer.
Geburtshelferkröte Steckbrief
- Klasse: Amphibia (Amphibien)
- Ordnung: Anura (Frösche und Kröten)
- Familie: Discoglossidae (Scheibenzüngler)
- Gattung: Alytes (Geburtshelferkröten)
- Art: Alytes obstetricans
- Verbreitung: Westeuropa: Nördlich bis Holland, südlioch bis zu den Alpen und der iberischen Halbinsel sowie im östlichen Teil Deutschlands
- Lebensraum: Laubwald, Süßwasser
- Maße und Gewichte: Körperlänge: 3,5 – 5,5 cm
Körperlänge der Larven: bis 67 mm - Nahrung: Alttiere: Insekten, Asseln, Nacktschnecken und Würmer. Frißt viele Schadinsekten und -schnecken.
Larven: Algen, Pflanzenreste, Einzeller und Pilze - Paarungszeit: Die Geburtshelferkröte ist unter den einheimischen Fröschen insofern ungewöhnlich, als sie an Land brütet und ihre Eier nicht im Wasser ablegt, sondern die eigentliche Brutpflege übernimmt. Das Männchen wickelt die Laichschnüre des Weibchens um seine Hinterbeine und trägt so die Schar der Eier bis zum Schlüpfen mit sich herum.
Eine weitere Besonderheit der Kröte ist, dass während der Paarungszeit ihr heller Ruf, der an den Klang einer Glasglocke erinnert, häufig zu hören ist. Sowohl die Männchen als auch die Weibchen machen ihn hörbar. Aus der Ferne klingen die Geräusche einer Gruppe von rufenden Kröten wie das Läuten einer Glocke, was erklärt, warum die Art auch als „Glockenfrosch“ bekannt ist. Ihr natürlicher Lebensraum waren die unverbauten Fluss- und Bachauen der Mittelgebirge. Heute bevorzugt die Kröte sonnige, warme und weitgehend vegetationslose Lebensräume wie Abgrabungen oder Bahndämme, aber auch Gärten und Weideflächen und stellt kaum besondere Ansprüche an ihre Larvengewässer. - Eier pro Gelege: 60
- Umwandlungszeit (Metamorphose): bis zu einem Jahr
- Besonderheiten: Geburtshelferkröten verringen den Winter im Winterschlaf. Die Paarung findet an Land statt. Das Männchen umklammert dabei das Weibchen, sammelt die vom Weibchen gelaichten Eier ein und windet die Eischnüre um seine Hinterbeine. Dieses Eibündel trägt das Männchen 20 – 50 Tage mit sich herum, bevor es die Eilast in einem Teich ablegt, wo die Larven ausschlüpfen und wie andere Kaulquappen bis zur Umwandlung im Wasser leben.
Systematik der Geburtshelferkröte ab Familie
Überfamilie: Discoglossoidea
Unterordnung: Archaeobatrachia
Ordnung: Froschlurche (Anura)
Überordnung: Laurasiatheria
Unterklasse: Höhere Säugetiere (Eutheria/Plazentalia)
Klasse: Amphibien (Amphibia)
Stamm: Chordatiere (Chordata)
Äußerliche Merkmale von Geburtshelferkröte
Die Geburtshelferkröte hat eine unscheinbare graubraune Oberseite, die mit kleinen Warzen bedeckt ist. Diese Warzen können rötlich gefärbt sein und verleihen der Kröte ein raues Aussehen. Die Bauchseite ist hellgrau und ungefleckt. Ein markantes Merkmal sind die senkrecht-schlitzförmigen Pupillen, die bei echten Kröten typischerweise quer verlaufen. Diese speziellen Merkmale helfen nicht nur bei der Identifikation der Art, sondern tragen auch zur Tarnung in ihrem natürlichen Lebensraum bei.Ein weiteres auffälliges Merkmal sind die gut sichtbaren Trommelfelle und Ohrendrüsen. Diese anatomischen Besonderheiten sind wichtig für das Hören und die Kommunikation innerhalb der Art. Während der Fortpflanzungszeit sind die Männchen leicht an den durchschimmernden Eiern zu erkennen, die sich unter ihrer Bauchdecke befinden. Dieses auffällige Merkmal hebt ihre Rolle als Brutpfleger hervor.
Lebensraum und Herkunft
Die Geburtshelferkröte bewohnt vor allem sonnige und warme Lebensräume in der Nähe von Gewässern. Typische Lebensräume sind Steinbrüche, Tongruben sowie strukturreiche Wiesen mit zahlreichen Versteckmöglichkeiten wie Steinhaufen oder Erdspalten. Diese Umgebung bietet nicht nur Schutz vor Fressfeinden, sondern auch Zugang zu Nahrungsquellen wie Insekten.Historisch gesehen war die Geburtshelferkröte in weiten Teilen Westeuropas verbreitet. In Deutschland sind ihre Vorkommen jedoch auf bestimmte Regionen beschränkt, insbesondere in den zentralen und westlichen Mittelgebirgen sowie im Südwesten des Landes. Die Art hat sich an verschiedene Lebensräume angepasst, benötigt jedoch immer Zugang zu geeigneten Fortpflanzungsgewässern.
Verhalten von Geburtshelferkröte
Die Geburtshelferkröte ist hauptsächlich nachtaktiv und zeigt ein zurückhaltendes Verhalten während des Tages. Sie versteckt sich tagsüber in Erdlöchern oder unter Steinen, um sich vor Fressfeinden zu schützen. In der Fortpflanzungszeit sind die Männchen aktiv auf der Suche nach Weibchen und geben dabei einen charakteristischen glockenartigen Ruf von sich, was ihnen auch den Namen „Glockenfrosch“ eingebracht hat.Während der Fortpflanzung übernehmen die Männchen eine aktive Rolle bei der Brutpflege, indem sie die Laichschnüre um ihre Hinterbeine wickeln und diese über mehrere Wochen mit sich herumtragen. Diese besondere Form der Brutpflege ist einzigartig unter europäischen Amphibienarten und zeigt das bemerkenswerte Sozialverhalten dieser Krötenart.
Paarung und Brut
Die Fortpflanzung der Geburtshelferkröte erfolgt zwischen März und August. Während dieser Zeit legen Weibchen ihre Eier ab, die dann von den Männchen übernommen werden. Die Männchen wickeln sich die Laichschnüre um ihre Hinterbeine, wodurch sie die Eier bis zum Schlüpfen schützen können. Dieser Prozess kann zwischen 20 und 45 Tagen dauern.Nach dem Schlüpfen suchen die Männchen geeignete Gewässer auf, um die Larven freizulassen. Diese Larven entwickeln sich entweder noch im selben Jahr zu kleinen Kröten oder überwintern als Larven im Gewässer, um im folgenden Frühjahr zur Metamorphose an Land zu gehen. Diese Flexibilität in der Fortpflanzung ermöglicht es der Art, sich an unterschiedliche Umweltbedingungen anzupassen.
Gefährdung
Die Geburtshelferkröte ist aufgrund des Verlusts ihres Lebensraums durch menschliche Aktivitäten gefährdet. Die Zerstörung kleiner Gewässer durch Zuschüttung oder Umweltverschmutzung stellt eine große Bedrohung dar. Auch klimatische Veränderungen wie längere Trockenperioden beeinträchtigen ihre Fortpflanzungsmöglichkeiten erheblich.Die Art steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten (Kategorie 3) und wird europaweit durch die FFH-Richtlinie geschützt. Schutzmaßnahmen sind notwendig, um ihren Lebensraum zu erhalten und ihre Populationen zu stabilisieren.
Quellen
Wikipedia – Geburtshelferkröte
BUND – Steckbrief Geburtshelferkröte
NABU – Artenporträt Geburtshelferkröte