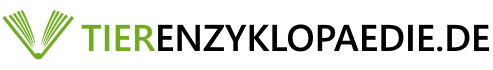Der Schwalbenstar, wissenschaftlich als Coracina melaschistos bekannt, ist ein faszinierender Vertreter der Familie der Raupenfänger, der sich durch seine markante schwarz-weiße Gefiederfärbung auszeichnet. Diese Art gehört zu den Singvögeln (Passeriformes) und findet sich vor allem in den Wäldern und Waldlichtungen Süd- und Südostasiens, wo sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit beobachtet werden kann.
In seiner Erscheinung zeigt der Schwalbenstar einen deutlichen Sexualdimorphismus, wobei die Männchen eine charakteristische schwarze Färbung auf den Flügeln aufweisen, die zusammen mit ihrem schiefergrauen Körper und Kopf einen attraktiven Kontrast bildet. Die Weibchen hingegen sind meist etwas unauffälliger gefärbt und passen sich so besser an ihre natürliche Umgebung an.
Im Verhalten ist der Schwalbenstar vorwiegend ein Einzelgänger oder lebt in kleinen Gruppen. Seine Ernährung besteht hauptsächlich aus Insekten, die er geschickt während des Fluges fängt oder in der Vegetation sucht. Mit seinem ausgeprägten Wandertrieb kann der Vogel abhängig von der Jahreszeit in verschiedenen Habitaten angetroffen werden, was ihn zu einer weit verbreiteten und anpassungsfähigen Art macht.
Als Teil des Ökosystems spielt der Schwalbenstar eine wichtige Rolle bei der Kontrolle von Insektenpopulationen. Für Ornithologen und Vogelbeobachter stellt die Art ein interessantes Beobachtungsobjekt dar, welches aufgrund seines Verbreitungsgebietes und seiner Lebensweise tiefe Einblicke in die Komplexität avifaunistischer Dynamiken gewährt.
Grauwangen-Raupenfänger Fakten
- Klasse: Vögel (Aves)
- Ordnung: Singvögel (Passeriformes)
- Familie: Raupenfänger (Campephagidae)
- Gattung: Raupenfänger (Coracina)
- Art: Trauerraupenfänger (Coracina melaschistos)
- Verbreitung: Südasien, von Indien bis nach Südostasien
- Lebensraum: Offenes Waldland, Waldränder, meist in Hügel- und Berggebieten
- Körpergröße: Ca. 28 cm
- Gewicht: Unbekannt
- Soziales Verhalten: Meist einzeln oder in Paaren, gelegentlich in kleinen Gruppen
- Fortpflanzung: Balzverhalten umfasst Schwanzspreizen und Kopfnicken; Nestbau auf Bäumen
- Haltung: In der Regel keine Haltung in menschlicher Obhut, da keine Zier- oder Haustierart
Systematik Grauwangen-Raupenfänger ab Familie
Grauwangen-Raupenfänger Herkunft und Lebensraum
Der Grauwangen-Raupenfänger (Coracina melaschistos) ist ein Vogel, der in Asien weit verbreitet ist. Ursprünglich stammt diese Art aus einem großen geographischen Gebiet, das von den nordöstlichen Regionen des indischen Subkontinents über die Gebiete des südlichen Chinas bis hin zu den südostasiatischen Ländern wie Laos, Vietnam, Kambodscha und Thailand reicht. Darüber hinaus findet man diesen Vogel auch in Teilen von Myanmar, Bhutan, Nepal sowie in einigen Regionen von Pakistan.
Der bevorzugte Lebensraum des Grauwangen-Raupenfängers umfasst unter anderem subtropische oder tropische feuchte Nieder- und Bergwälder. Dieser Vogel ist anpassungsfähig und kann in verschiedenen Höhenlagen bis zu etwa 2.500 Metern über dem Meeresspiegel angetroffen werden. Seine Anwesenheit markiert oft die natürlichen Waldränder sowie sekundäre Vegetationen, die von menschlichen Aktivitäten beeinflusst sind.
Die Nähe zu dicht bewachsenen Habitaten ist essentiell, da sie ihm Schutz und Zugang zu Nahrungsquellen bietet. Coracina melaschistos zeigt eine Präferenz für Gebiete mit reichlich Insektenvorkommen, die seine Hauptnahrung darstellen. Als Bewohner dieser ökologischen Nischen erfüllt der Grauwangen-Raupenfänger eine wichtige Rolle im Ökosystem als Kontrolleur von Schadinsektenpopulationen.
Grauwangen-Raupenfänger äußere Merkmale
Der Schwarzflügel-Raupenfänger (Coracina melaschistos) ist eine Vogelart aus der Familie der Raupenfänger (Campephagidae), die durch markante äußerliche Merkmale charakterisiert wird. Das Gefieder des Schwarzflügel-Raupenfängers weist eine überwiegend schiefergraue Färbung auf der Oberseite auf, während die Unterseite heller, mit einer Tönung von hellem Grau bis Weiß, gefärbt ist. Die markanteste Eigenschaft ist jedoch, wie der Name bereits andeutet, die schwarze Färbung der Flügeldecken und der Schwanzfedern, die einen auffälligen Kontrast zur restlichen Körperfarbe bildet.
Die Geschlechter des Schwarzflügel-Raupenfängers zeigen einen gewissen Sexualdimorphismus, bei dem die Männchen in der Regel etwas intensiver gefärbt sind, während die Weibchen tendenziell ein matteres Farbschema aufweisen. Das Weibchen kann zudem eine weniger auffällige schwarze Flügelfärbung zeigen. Bei beiden Geschlechtern sind die Augen von einem markanten weißen Augenring umgeben, der die Kopffärbung betont und zum charakteristischen Aussehen dieser Art beiträgt.
Jungvögel des Schwarzflügel-Raupenfängers unterscheiden sich durch ihr blasseres Gefieder und weniger definierte Farbabgrenzungen von den ausgewachsenen Exemplaren. Dennoch ist auch bei ihnen die namensgebende schwarzgefärbte Flügelzeichnung ersichtlich, die mit zunehmendem Alter an Intensität gewinnt. Der Schnabel des Schwarzflügel-Raupenfängers ist kräftig und leicht gebogen, was ihm ein robustes Aussehen verleiht. Die Beine und Füße sind von mittlerer Länge und eher unauffällig gefärbt.
Soziales Verhalten
Die Recherche hat keine Informationen zum Sozialverhalten des Grauwangen-Raupenfängers ergeben.
Paarungs- und Brutverhalten
Leider muss festgestellt werden,dass die spezifischen Informationen zum Brut- und Paarungsverhalten des Grauwangen-Raupenfängers nicht in meiner Wissensdatenbank vorhanden sind. Es wurden keine detaillierten Erkenntnisse zu diesem Thema im Rahmen meiner aktuellen Datenlage gefunden.
Grauwangen-Raupenfänger Gefährdung
Bei der Recherche über den Grauwangen-Raupenfänger (Coracina melaschistos) liegen zur gegenwärtigen Zeit keine spezifischen Informationen über Gefährdungen oder Schutzmaßnahmen vor, die einen detaillierten Bericht ermöglichen würden. Es ist anzumerken, dass die Verfügbarkeit von Informationen zu vielen Tierarten, insbesondere zu solchen, die nicht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, limitiert sein kann. Der Mangel an Daten macht es schwierig, präzise Aussagen über den Gefährdungsstatus und erforderliche Schutzmaßnahmen zu treffen. Wissenschaftliche Institutionen und Naturschutzorganisationen bemühen sich kontinuierlich, Wissenslücken zu schließen und den Erhalt der Artenvielfalt zu sichern.