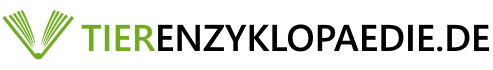Die US-Lebensmittelbehörde (FDA) prüft zurzeit die Zulassung von gentechnisch manipuliertem Lachs. Obwohl nach Aussage der Biotechnologiefirma „Aqua Bounty Farms“ frühestens 2004 mit der behördlichen Entscheidung gerechnet wird, ist in den USA schon jetzt ein Streit um den so genannten Frankenfish entbrannt. Der Bundesstaat Maryland hat als erster gesetzlich festgelegt, dass Gen-Fische zwar gezüchtet werden dürfen, aber es von den Fischfarmen keinerlei Verbindung zu natürlichen oder öffentlichen Wasserwegen geben darf.
Dem Senat Kaliforniens liegt ein Gesetzentwurf vor, der den Import, Transport, Besitz und die Freisetzung von Gen-Fischen mit einer Strafe von bis zu 50.000 Dollar ahnden will. Mit einem anderen Entwurf soll die Kennzeichnungspflicht für genmanipulierte Fische eingeführt werden. So viel Ablehnung schafft Solidarität unter den Gentech-Unternehmen. George Gough, Lobbyist für eine der größten Gen-Pflanzenschmieden, Monsanto Co., warnte deshalb, dass ein Anti-Gen-Fisch-Gesetz einen Präzedenzfall schaffen könne. „Ist die Tür erst einmal zugefallen, könnten wir vielleicht niemals den Schlüssel wiederfinden, um sie erneut zu öffnen.“
Die Frankenfish-Gegner sehen die Gefahr, dass einige der Gen-Lachse in die Wildbahn entkommen werden. Schon heute entwischen bei den herkömmlichen Lachsfarmen in schöner Regelmäßigkeit Herrscharen an Zuchtfischen. Da in den Körpern der Gen-Lachse fremde Wachstumsgene für eine beschleunigte Größen- und Gewichtszunahme sorgen, gehen Experten davon aus, dass Wildlachse die Turbo-Artgenossen bei der Fortpflanzung vorziehen werden. Das könnte dazu führen, dass die Wildpopulation ausstirbt. Zu diesem Ergebnis kam zum Beispiel eine Studie der Purdue-Universität in Indiana aus dem Jahre 1999. Die Genforscher von Aqua Bounty versuchen die Einwände zu entkräften und verweisen darauf, dass ausschließlich unfruchtbare Weibchen gezüchtet würden, die sich in der freien Wildbahn gar nicht fortpflanzen könnten. Jurassic Park lässt grüßen.
Quelle: Greenpeace